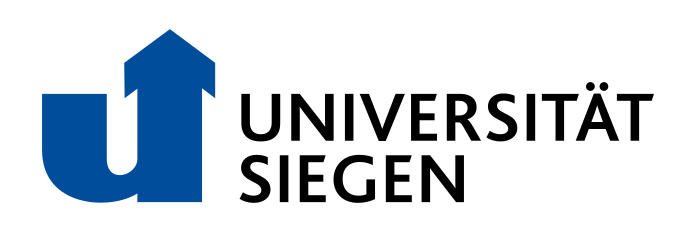An der Uni Giessen, Professur für Ernährungssoziologie, Institut für Wirtschafts-lehre des Haushalts und Verbrauchsforschung, Fachbereich Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement, ist ab dem 01.11.2019 eine Teilzeitstelle im Umfang von 75 % einer Vollbeschäftigung mit einer/einem Wissenschaftlichen Mitarbeiter/in für die Dauer von zunächst 3 Jahren zu besetzen.
Weitere Information zur Stelle und den gewünschen Voraussetzungen finden Sie hier.
Bei Rückfragen steht Ihnen Dr. Stefan Wahlen per E-Mail unter stefan.wahlen@uni-giessen.de zur Verfügung.